Folge 11 – Konsens
In dieser Folge geht es um Konsens, also Zustimmung in Bezug auf sexuelle Handlungen. Wir freuen uns über Fragen, Kommentare und Feedback.
Das Script zu dieser Folge hat Louzie geschrieben, wir werden es bald hier hoch geladen haben und bedanken uns ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit!
Hier findest du mehr Literatur und Quellen zum Thema:
- Friedman, Jaclyn / Valenti, Jessica (2008): Yes means yes! Visions of female sexual power & a world without rape. Berkeley, USA: Seal press.
- Holst, Sina / Montanari, Johanna (Hrsg) (2017): Wege zum Nein. Emanzipative Sexualitäten und queer-feministische Visionen. Beiträge für eine radikale Debatte nach der Sexualstrafrechtsreform in Deutschland 2016. Münster: edition assemblage.
- Wildfell, Helen (2015): Consensuality. Navigating Feminism, Gender, and Boundaries. Towars loving relationships.
Hier bekommst du Hilfe, wenn du sexualisierte Gewalt erlebt hast:
https://weisser-ring.de/praevention/tipps/vergewaltigung
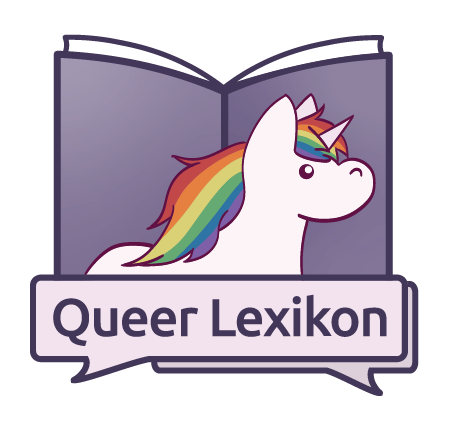


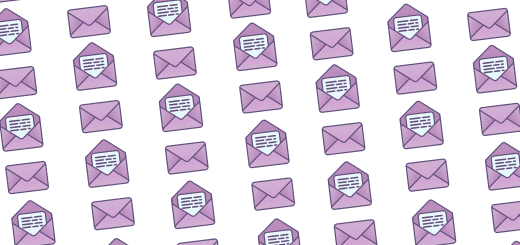


3 Antworten
[…] ist der Tonspur des Videopodcastes der Buchstabensuppenepisode zu Konsens. Zur Fassung mit Bild hier entlang. KategorienAudiopodcast, Audiopodcast Buchstabensuppe Schlagwörteraudio, audiopodcast, […]
[…] Konsens – Queer Lexikon […]
[…] Wir erklären hier etwas ausführlicher zu […]