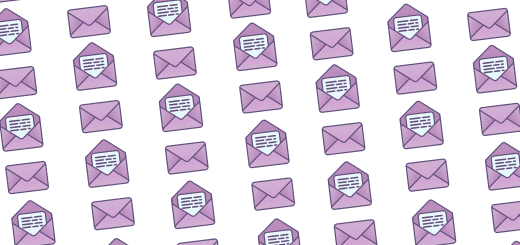Being okay
CN: Mobbing, Gendernormen, Jobverlust, Nazis
Als wir uns zum ersten Mal gegenübersaßen, ging ich davon aus, wir würden nicht viel miteinander anfangen können. Unsere Stile waren komplett unterschiedlich: Während ich ein wandelndes Gefärbter-Untercut-und-Karohemd-Klischee war, kam sie in Make-up und schicken Blusen ins Büro.
Einen Undercut trug sie zwar ebenfalls. Aber ihr Gesamtbild irritierte mich so sehr, dass ich ihn lange gar nicht als die queere Symbolik erkannte, die er war. Zum Glück war mir wenigstens bewusst, dass ich – trotz definitiv bestehender Codes und Ästhetiken in der Community – nicht am Aussehen erkennen kann, ob eine Person queer ist oder nicht. Irgendwann, als wir schon keine Kolleginnen mehr waren, habe ich sie dann also mal gefragt, und es stellte sich heraus: Sie ist bi, genau wie ich. Bei der Ablehnung, die bisexuelle Menschen selbst in queeren und progressiveren Kontexten immer wieder erfahren, hätte ich gerne früher gewusst, dass ich mit meiner Orientierung gar nicht alleine im Team bin. Aber darum soll es hier nicht vorrangig gehen.
I told my therapist about you
Mit der Zeit bewies sich, dass meine Sorge unbegründet gewesen war: Wir beide kamen gut miteinander aus und arbeiteten gerne und gut zusammen. Sie stand in der Hierarchie etwas höher, legte darauf aber nicht sonderlich viel Wert – und war, wie sich herausstellte, auch nur wenige Jahre älter als ich. Damit war sie dann auch schon die Einzige im Team: Die anderen Kolleg*innen waren zum Großteil deutlich älter, nicht selten doppelt so alt wie ich. Aber hey, die meisten waren trotzdem sehr nett. Und irgendwie war ich das ja auch schon gewohnt.
Nach einer Weile zwangen uns die Umstände, uns beide andere Jobs zu suchen, und unsere Wege trennten sich. Und dann stand ich auf einmal da, völlig überrumpelt davon, wie sehr mich das mitnahm. Schließlich waren wir doch nur Kolleginnen gewesen, und so unterschiedlich noch dazu. Oder?
Zum Glück hatte ich eine tolle Therapeutin, bei der ich viel über den verlorenen Job redete. Die betriebsinterne Krise, die dazu geführt hatte, beschäftigte mich anders als erwartet kaum. Über besagte Kollegin redete ich jedoch noch viel. Vielleicht nicht wirklich eine große Überraschung. Aber wie immer in dieser normativen Gesellschaft ist es kompliziert.
“Du siehst ja aus wie ein Junge”
Viele Faktoren wie dass ich weiß, dünn und nicht sichtbar behindert bin, sorgen dafür, dass ich zumindest in den Medien häufiger als andere Menschen sagen kann: “Hey, die sieht ja aus wie ich!” (Oder vielmehr gar nicht so bewusst darüber nachdenken muss.) Selbst cis Frauen mit kurzen Haaren sind nicht unmöglich zu finden.
Meine persönliche Realität sieht da leider immer noch anders aus. Mein Arbeitsumfeld der letzten Jahre lässt sich ganz gut mit dem bekannten Klischee beschreiben, dass dort mehr weiße mittelalte cis Typen mit demselben Vornamen vertreten sind als jüngere Menschen, Frauen oder gar weitere Geschlechter. Da es mir leichter fällt, mich etwa mit bisexuellen Männern oder nichtbinären Menschen mit demselben Hobby zu identifizieren als mit den meisten cis Frauen, gibt es letztere auch in meinem Freund*innenkreis kaum. Wer mir das Gefühl von Bestätigung gibt, Frau sein zu “dürfen”, obwohl ich nicht dem strengen gesellschaftlichen Klischee entspreche, sind dann im Zweifel die vielen tollen trans Frauen in meinem Leben. Und selbst die haben halt unterm Strich doch eine andere Lebensrealität als ich.
Aufgewachsen bin ich auf dem Dorf, wo die einzige Friseurin mir aktiv auszureden versuchte, mir die Haare kürzer schneiden zu lassen. Als ich noch lange Haare hatte, aber mal einen kurzen Schnitt brauchte, weil meine Haare kaputt waren, meinte ein Mitschüler: “Jetzt siehst du aus wie ein Junge!” Als ich schließlich mit queeren Begriffen in Berührung kam, zweifelte ich sogar eine Weile selbst daran, überhaupt weiblich zu sein.
Das Private ist strukturell
Auf dem Weg zu meiner weiterführenden Schule hingen vor Wahlen Plakate von ganzen drei Nazi-Parteien. Als meinen Mitschüler*innen in der Pubertät aufging, dass “kein Interesse an BHs und Make-up haben und sich nicht panisch jeden Tag rasieren” ein vortrefflicher Vorwand für Mobbing ist, testesten sie das gleich ausgiebig an mir aus. Lehrerinnen mit kurzen Haaren waren, wenn ich so darüber nachdenke, gar nicht so selten an dieser Schule. Schade dann nur, wenn das dann trotzdem dieselben Leute sind, die sich küssende Mädchen “komisch” finden. Übrigens: Auch wer “Frau” oder “woman” googelt, bekommt noch immer größtenteils Bilder von solchen mit langen Haaren angezeigt.
Kein Wunder also, dass ich froh war, mal mit einer Person zusammenzuarbeiten, die mir ähnlicher war. Die, als einmal der Kommentar “Das ist ja ein komisches Foto von dieser Künstlerin, da sieht sie aus wie ein Mann” fiel, mit “Das ist doch einfach ihr androgyner Stil!?” dagegenhielt. Und deren Erfahrungsvorsprung sich nicht komplett uneinholbar anfühlte, sondern eher auf dem Level von “Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?” bewegte. Manchmal sage ich, aus professionell-queerfeministischer Sicht war es ein bisschen, wie eine große Schwester zu haben.
Was mich aber überforderte, war, dass da plötzlich so ein “Dich zu treffen hat mein Leben verändert” im Raum stand. Unausgesprochen natürlich, um sie nicht auch noch zu überfordern. Ein: “Wir kennen uns kaum, aber du bist die Erste von uns, die ich (offline/im Arbeitskontext) kennenlerne.” Als wäre es mein persönliches Versagen, nicht längst in einem Haufen queerer cisweiblicher Freundinnen zu schwimmen. Mit der Zeit schlug das dann um in Wut auf diese Gesellschaft, die es uns so schwer macht, einander und unseren Platz in der Welt zu finden.
Just like me (enough)
Wie es der Zufall wollte, hatte die Kollegin sogar denselben Vornamen wie eine der Personen, die mich zu Schulzeiten gemobbt hatten. Irgendwie witzig – und ziemlich heilsam. Spannend auch, wie ich inspiriert von ihr plötzlich Lust bekam, mit einer etwas feminineren Version von Androgynität herumszuspielen: Den Pullover tragen, den ich mal spontan für ein Bewerbungsgespräch gekauft und eigentlich hatte weggeben wollen. Das Make-up benutzen, das ich für den (1) Tag im Jahr, den ich für gewöhnlich Lust darauf habe, in der Schublade liegen hab. Hatte ich doch gerade gesehen, wie verdammt powerful der Undercut an cis Frauen einfach ist, sodass wir ihn mit was auch immer wir wollen kombinieren können und doch nie wieder im Stereotyp von Cis-hetero-Weiblichkeit landen. (Nicht, dass es was Schlechtes wäre, so auszusehen, wenn du dich damit wohlfühlst, obviously.) Eigentlich sogar ziemlich cool, eine Person zu kennen, die mir ähnlich ist und doch anders.
Fast, als wäre es gar nicht Cisweiblichkeit per se, mit der ich mich nicht identifizieren kann


Sind die ehemalige Kollegin und ich nun beste Freundinnen? Habe ich jetzt meine Karohemden in die Altkleidersammlung gegeben? Nein. Aber es tat gut, eine Person zu haben, neben der ich mich mit meiner Art (cis-)weiblich zu sein einfach mal nicht falsch fühlte.
Ich könnte jetzt hier noch einen langen Absatz einfügen nach dem Motto: “Stellt mehr junge Menschen ein! Stellt mehr Frauen und Menschen anderer Geschlechter ein! Stellt mehr Leute unabhängig von ihrem Aussehen ein!” Aber wenn du auf dem Blog vom Queer Lexikon gelandet bist, weißt du all das vermutlich schon. Dann ist dieser Bericht einfach ein: Falls du Ähnliches erlebt hast, bist du damit nicht allein. Ich wünsche dir, dass du deine Leute findest, und heilen kannst.
Vielleicht geh ich jetzt einfach noch ‘ne Runde heulen. Und dann den Rest von uns suchen.